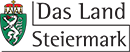Ist ein Elektroauto umweltfreundlich?
Mythen und Fakten zur Klimabilanz von E-Autos
E-Mobilität ist ein in der Öffentlichkeit sehr heiß diskutiertes Thema. Da wundert es nicht, dass allerlei Unklarheiten und sogar Fehlinformationen durchs Internet kursieren - gerade auch in Hinsicht auf die Umweltbilanz von E-Autos.
Mehr Informationen rund um die Vorteile der Elektromobilität erhalten Sie außerdem in unserem Ratgeber für Elektromobilität.
Viele Kritikpunkte gegenüber E-Autos betreffen dessen Rohstoffverbrauch: Der Vorwurf lautet, dass wertvolle und seltene Rohstoffe unter fragwürdigen Bedingungen abgebaut und nach der Nutzung des Fahrzeugs gedankenlos entsorgt werden. Wie viel Wahrheit in dieser Aussage tatsächlich steckt, erfahren Sie hier.
 Video: Mythos 1: E-Autos sind umweltschädlicher als Verbrenner
Video: Mythos 1: E-Autos sind umweltschädlicher als Verbrenner
Zunächst zu den Rohstoffen selbst: Für E-Autos kommen primär vier Rohstoffe zum Einsatz.
Lithium findet sich als Ladungsträger in den Akkus der E-Autos wieder. Es wird darüber hinaus für alle wiederaufladbare Batterien verwendet (etwa Akkus in Notebooks, Tablets, Smartphones etc.). Weitere Verwendungsbereiche von Lithium umfassen die Keramik- und Glasindustrie sowie die Herstellung von Schmierfetten, Kunststoffen und auch Klimaanlagen. Mit zunehmendem Bedarf an wiederaufladbaren Batterien steigt natürlich auch die Nachfrage nach dem Rohstoff, aber Lithium ist in ausreichenden Mengen vorhanden.
Am meisten Lithium wird in Australien mit jährlich ca. 42.000 Tonnen im Erzbergbau abgebaut, gefolgt von Chile mit 18.000 Tonnen mittels der Extraktion aus Salzseen. Weltweit werden die Reserven auf ca. 17.000.000 Tonnen geschätzt, was als ausreichend gewertet wird.
Kobalt sorgt unter anderem dafür, dass die Akkus nicht überhitzen, schneller laden und länger halten. Weltweit werden die Kobaltreserven aktuell auf 25 Millionen Tonnen geschätzt, was für die nächsten Jahrzehnte ausreichen wird. Auch darüber hinaus wird Kobalt in vielen Produkten verwendet - etwa in anderen Akkutypen, in der Metallindustrie, der Pigmentindustrie, der Luft- und Raumfahrt sowie in fossilen Verbrennern und als Katalysator bei der Entschwefelung von Benzin.
Die weltweit größten Vorkommen werden im Copperbelt, einer Industrieregion in Sambia und im Südosten der DR Kongo, angenommen. Die DR Kongo ist dabei Weltmarktführer im Kobalt-Export: 2023 stammten 170.000 Tonnen der weltweit 230.000 Tonnen an gefördertem Kobalt aus dem zentralafrikanischen Land.
Tantal wird vorwiegend für Kondensatoren mit hoher Kapazität bei gleichzeitig geringer Größe verwendet. Tantal wird für Elektronik im Allgemeinen sowie bei Superlegierungen für Turbinen und Flugzeugtriebwerke eingesetzt. Da das Metall ungiftig und gegen Körperflüssigkeiten inert ist, wird es auch für Implantate, etwa als Knochennagel, eingesetzt.
Seltene Erden sind von der Namensgebung her missverständlich: Zum Zeitpunkt ihrer Entdeckung im 18. Jahrhundert erwiesen sie sich als Bestandteil komplexer Oxide, die damals als „Erden" bezeichnet wurden. Außerdem schienen diese Mineralien knapp zu sein, und so wurden diese neu entdeckten Elemente „seltene Erden" genannt. Tatsächlich sind diese Rohstoffe recht häufig vorhanden und existieren in vielen funktionsfähigen Lagerstätten auf der ganzen Welt. Die seltenen Erden Dysprosium, Neodym, Praseodym, Samarium und Terbium werden neben für Elektromotoren auch für Dauermagnete, Flugzeugmotoren, Glas- und Emaillefärbungen, Laser, CD-Player, Kernspintomografen, Festplatten, Raumfahrttechnik oder als Leuchtstoffe verwendet.
Zusammengefasst muss gesagt werden, dass jeder Abbau von Rohstoffen auf der Erde unter ökologischen und sozialen Aspekten erfolgen sollte. Unabhängig vom abgebauten Rohstoff sollte dieser Grundsatz immer gelten. Zumeist steht der Profit jedoch im Vordergrund und in politisch instabilen Ländern sind Korruption und Kinderarbeit trotzt vieler internationaler Bemühungen dominierend. Dem Thema der Abbau- und Arbeitsbedingungen muss man sich global mehr widmen.
Bei der Lithiumgewinnung in Chile sind Themen wie Trockenheit, Abwanderungen, versiegte Flussläufe etc. allgegenwärtig. Lithium wird in der Atacama-Wüste abgebaut, die in der Literatur überwiegend als trockenste Wüste der Welt bezeichnet wird. Zur Gewinnung von Lithium wird jedoch lithiumhaltiges Salzwasser und kein Trinkwasser verwendet, da dies keine Lithium-Salze enthält. Lithiumhaltiges Salzwasser aus unterirdischen Seen wird an die Oberfläche gebracht und in großen Becken verdunstet. Die verbleibende Salzlösung wird über mehrere Stufen weiterverarbeitet, bis das Lithium zum Einsatz in Akkus geeignet ist.
Ein Zusammenhang zwischen der Trockenheit und dem Lithiumabbau liegt bis dato nicht vor.
Die Kobaltextraktion im Rahmen des Kupfer- oder Nickelbergbaus erfolgt global in Regionen ohne ausgeprägte Wasserknappheit, von wenigen australischen Bergwerken abgesehen. Insgesamt sind Risiken der Wasserknappheit für die für Kobalt relevanten Kupfer- und Nickelbergwerke wesentlich geringer ausgeprägt als beispielsweise für Kupferlagerstätten in Chile und Peru.
Auch wenn es stimmt, dass die für E-Auto-Akkus verwendeten Rohstoffe teils unter fragwürdigen Bedingungen gefördert werden, dürfen sie dennoch nicht als alleiniger Verursacher bezeichnet werden. Wiederaufladbare Akkus sind in allen Elektrogeräten (Smartphones, Tablets, Laptops etc.) ähnlich aufgebaut und auch in vielen anderen Gebrauchsgegenständen des Alltags - etwa Klimaanlagen - kommen Rohstoffe aus dem internationalen Bergbau zum Einsatz.
Der Akku ist ein Schlüsselelement, wenn es um die Zukunftsfähigkeit der Elektroautos geht. Nicht nur wegen der Reichweite und der Kosten, sondern auch für die Gesamtumweltbilanz ist er entscheidend. Gegenwärtig stellen Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus) den am weitest verbreiteten Typ dar. Die rasante Technologieentwicklung trägt zum enormen Kostenrückgang sowie der höheren Energiedichte der Akkus bei.
Die Lebensdauer der Li-Ion-Akkus liegt bei mindestens zehn Jahren bzw. rund 4.000 Ladezyklen, wobei laut Herstellern aktuell eingesetzte Akkus weit über diesen Zeitraum hinaus funktionsfähig bleiben und daher auf mindestens 150.000 km bzw. 15 Jahre ausgelegt sind. Die Akkus erweisen sich deswegen als sehr beständig. Auch die zur Verfügung stehende Akkukapazität sinkt nur geringfügig, sodass die Akkus nach der Nutzung im Elektroauto weitere nachhaltige Funktionen als Speicher erfüllen können - etwa als stationärer Zwischenspeicher in einem Gebäude, um Strom aus erneuerbaren Energien zu puffern. Ein Großteil der Rohstoffe lässt sich letztlich durch die Müllverwertung wiedergewinnen. Hohe Recyclingraten von Li-Ion-Akkus sind technisch möglich, bislang existieren aufgrund des vorerst geringen Bedarfs jedoch erst wenige Recyclinganlagen.
Der Recyclingprozess eines E-Auto-Akkus funktioniert konkret so: Der E-Auto-Akku wird z. B. in der Werkstatt ausgebaut und dann von einem Recyclingbetrieb übernommen. Dann wird der Akku entladen und in Module zerlegt. Wertstoffe wie z.B. Elektronikbauteile, Kabel, Gehäuse etc. werden einem Recyclingprozess zugeführt. Der gewonnene Strom beim Entladen wird ins eigene Betriebsnetz eingespeist. Die entladenen Module werden thermisch vorbehandelt und mechanisch aufbereitet. Die Recyclingquote beträgt rund 70 Prozent. Es werden Zwischenprodukte wie etwa Aktivmaterial (Cobalt, Nickel, Mangan, Lithium), Aluminium, Aluminium-Kupfer und Eisen hergestellt. Diese Rohstoffe werden an verschiedene Hütten geliefert, die diese weiter verwerten.
Besonders zu beachten ist, dass Li-Ion-Akkus von E-Autos eine Spannung von bis zu 700 V haben und aus brennbaren sowie reaktiven Komponenten (z. B.Elektrolyt, Kunststoffe) bestehen, die während des Recyclingprozesses deaktiviert werden müssen. Daher benötigt man für das Entladen und Demontieren speziell ausgebildete Techniker*innen - erst dann können die Wertstoffe zurückgewonnen werden.
Es heißt, in Sachen Klimabilanz bringen E-Autos kaum Vorteile, im Gegenteil: Durch die notwendige Infrastruktur werden Emissionen und Bodenversiegelung sogar noch weiter vorangetrieben. Aber stimmt dieser Mythos? Mehr dazu erfahren Sie hier:
Elektromotoren arbeiten leise und sind lokal abgasfrei, im Betrieb selbst emittieren sie also keine Luftschadstoffe. Damit reduzieren sie neben Verkehrslärm auch die Belastung durch Feinstaub und CO2 in der direkten Umgebung - was sich gerade in Städten schnell bemerkbar macht. Der Beitrag von E-Fahrzeugen zur Reduktion der Treibhausgase ist stark davon abhängig, mit welchen Energieträgern der Strom vor dem Aufladen produziert wurde.
Eins vorweg: Eine komplett emissionsfreie und ressourcenschonende Mobilität können auch Elektroautos nicht erzielen. Unter Berücksichtigung des gesamten Fahrzeuglebenszyklus (inkl. Produktion) sowie des heimischen Stroms (inkl. Importe) können Elektrofahrzeuge jedoch um bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgasemissionen verursachen als fossil betriebene Fahrzeuge.
Beispielsweise emittiert ein benzinbetriebener Kompaktklassewagen rund 226 Gramm CO2-Äquivalent pro Personenkilometer, während ein vergleichbares E-Auto nur knapp 100 Gramm verantwortet. Wird es mit 100 Prozent Ökostrom betrieben, sinkt dieser Wert sogar auf rund 65 Gramm. Lediglich die Bahn verursacht im Vergleich verschiedener Antriebe weniger Emissionen als das E-Auto ( Umweltbundesamt, 2024). Verbrenner (Diesel und Benzin) stoßen den Großteil an Emissionen im täglichen Fahrbetrieb aus. Die CO2-Emissionen von E-PKW hingegen resultieren im Wesentlichen aus der Stromproduktion.
Umweltbundesamt, 2024). Verbrenner (Diesel und Benzin) stoßen den Großteil an Emissionen im täglichen Fahrbetrieb aus. Die CO2-Emissionen von E-PKW hingegen resultieren im Wesentlichen aus der Stromproduktion.
In Österreich gibt es rund 5 Millionen zugelassene PKWs, davon sind aktuell 3 Prozent elektrisch betrieben (ca. 155.000 Fahrzeuge,  Statistik Austria, 2023). Jeder PKW in Österreich legt im Schnitt etwa 13.000 km zurück (
Statistik Austria, 2023). Jeder PKW in Österreich legt im Schnitt etwa 13.000 km zurück ( VCÖ, 2023).
VCÖ, 2023).
Elektroautos sind dank ihres hohen Wirkungsgrades jedoch deutlich energieeffizienter als KFZ mit Verbrennungsmotoren. Der Gesamtenergieverbrauch kann durch einen Umstieg von fossil auf elektrisch betriebene Fahrzeuge also gesenkt werden. Bei 1 Million Fahrzeugen wären es 2,6 TWh oder 3,6 Prozent. Der Stromertrag einer kleinen Photovoltaikanlage (ca. 18 m2 Fläche und 2,6 kWp) deckt den Strombedarf eines E-Autos ab; ein 3-MW-Windrad deckt den Bedarf von 2.700 E-Autos.
Würden alle PKW also elektrisch fahren, würde der Strombedarf im Land um etwa 13 TWh steigen - rund 15-18 Prozent des aktuellen Strombedarfs im Land (bei einer Jahresfahrleistung von 13.000 km und einem Fahrzeugbestand von 5 Millionen PKW).
Für dieses längerfristige Szenario sind jedoch die Entwicklung der Mobilitätswende und entsprechende PKW-Nutzung sowie technologische Weiterentwicklungen bzw. Optimierungen zu bedenken. Wie eine aktuelle Studie der TU Wien zeigt, ist eine 100-prozentige Abdeckung des heimischen Strombedarfs mit erneuerbarer Energie bis zum Jahr 2030 umsetzbar - und das ohne signifikante Mehrkosten. Demnach liegt das Ökostrom-Potenzial im Jahr 2030 bei 31 TWh. Zudem wird die Batterie des E-Autos mit seiner Speicherkapazität zukünftig ein wertvoller Teil eines intelligenten Stromnetzes sein ( TU Wien, 2017).
TU Wien, 2017).
Und nicht zuletzt sollte berücksichtigt werden, dass auch für fossile Infrastrukturen Strom verwendet wird. In Österreich werden jährlich rund 10 Milliarden Liter Treibstoff benötigt. Die Herstellung dieser 10 Milliarden Liter Treibstoff bedingt einen Stromeinsatz von rund 800 Millionen kWh. Das entspricht einer durchschnittlichen Jahresfahrleistung von 410.000 E-Autos.
Ein eigenes Auto zu besitzen ist oftmals kostspielig. Von Service- und Instandhaltungskosten über Parkgebühren und Garagen- bzw. Parkplatzkosten bis hin zu Autobahnvignette und Treibstoff. Dazu kommen verkehrsbedingte Hürden wie Staus - gerade im urbanen Raum muss das eigene Auto oft pragmatischen Argumenten in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis weichen.
Es steht ebenfalls außer Frage, dass sich unser Mobilitätsverhalten in Richtung einer sanften und nachhaltigen Mobilität bewegen muss. Denn allgemein nutzen wir Autos höchst ineffizient: Rund 572.000 Autofahrer:innen lenken nur ein paar Mal im Jahr ein Auto, weitere rund 690.000 nur ein paar Mal im Monat. De meisten Autos verbringen etwa 23 von 24 Stunden täglich stehend - dazu kommen mehr als 1,3 Mio. Zweit- und Drittautos, die im Schnitt nicht einmal eine halbe Stunde am Tag im Einsatz sind ( VCÖ, 2020).
VCÖ, 2020).
Hier bieten E-Carsharing, Fahrrad-Sharing etc. eine kostengünstige und umweltschonende Alternative für Personen, die die Vorzüge eines Autos nutzen möchten - ohne dabei die Nachteile für Umwelt und Börserl abzubekommen. Eine höhere Auslastung der Fahrzeuge durch geteilte Nutzung ermöglicht im Vergleich zum exklusiven Gebrauch potenziell eine effizientere Ressourcenverwendung. Bei richtigem Einsatz und Vermeidung von Rebound-Effekten kann E-Carsharing einen Teil dazu leisten, die Personenmobilität auf Klimakurs zu bringen. Mittlerweile nutzen mehr als 100.000 Haushalte in Österreich Carsharing ( VCÖ, 2018).
VCÖ, 2018).
Mehr Infos und eine Liste an E-Carsharing-Partner:innen in der Steiermark finden Sie auf der Unterseite "Mein Elektroauto".
Hörte man vor einigen Jahren noch den häufig geäußerten Kritikpunkt, die heimische E-Ladeinfrastruktur sei viel zu spärlich für eine zielführende E-Auto-Nutzung, so sieht das heute grundlegend anders aus: Gab es Ende 2018 noch ca. 4.800 Ladepunkte in ganz Österreich (4.142 Normalladepunkte und 686 Schnellladepunkte;  austriatech, 2019), ist die Infrastruktur für E-Autos inzwischen rasant expandiert. 2024 sind mit rund 24.000 öffentlichen Ladepunkten (18.975 Normalladepunkte, 3.668 Schnellladepunkte und 1.366 Ultraschnellladepunkte) fünfmal so viele Ladepunkte vorhanden wie noch vor fünf Jahren. (
austriatech, 2019), ist die Infrastruktur für E-Autos inzwischen rasant expandiert. 2024 sind mit rund 24.000 öffentlichen Ladepunkten (18.975 Normalladepunkte, 3.668 Schnellladepunkte und 1.366 Ultraschnellladepunkte) fünfmal so viele Ladepunkte vorhanden wie noch vor fünf Jahren. ( austriatech, 2024).
austriatech, 2024).
Zudem lädt der Großteil aller österreichischen E-Autobesitzer:innen das Auto zu Hause auf. Zwischen 80 und 90 Prozent aller Ladungen erfolgen zuhause oder am Arbeitsplatz, und nur circa 10 Prozent nutzen unterwegs Ladepunkte auf der Strecke.
Doch viele Ladestationen zur Verfügung zu haben ist eine Sache - eine andere Sache ist es jedoch, diese auch zu finden. Über den  E-Ladestellenfinder des BMK können Sie schnell die nächste geeignete Ladestation in Ihrer Nähe finden.
E-Ladestellenfinder des BMK können Sie schnell die nächste geeignete Ladestation in Ihrer Nähe finden.
Mehr Infos zum Laden von E-Autos finden Sie auf der Unterseite " Mein Aufladen".
Mein Aufladen".

Die Ladeleistungen von E-Autos nehmen stetig zu. Können Schnellladestationen aktuell 50 kW zur Verfügung stellen, können Ultraschnelladestationen bis zu 350 kW Leistung anbieten. Mit solchen Ladeleistungen ist es möglich, innerhalb von 10 bis 15 Minuten 200-300 km nachzuladen.
Die Ladedauer eines E-Autos lässt sich auch recht leicht errechnen, indem man die Batteriekapazität durch die Ladeleistung des Elektroautos teilt. Wird z.B. ein 85 kWh Akku mit 22 kW geladen, ergeben sich 3,9 Stunden Ladezeit. Die Ladeleistung ist jedoch nicht konstant, sondern nimmt mit zunehmendem Akkustand ab. Weitere Einflussfaktoren sind die Kapazität und der Typ der Batterie, die Anschlussleistung der Ladestation, die Ladetechnik des Elektroautos, der Ladestand des Akkus sowie Witterungseinflüsse.
Da die Belastung von Stromnetz und E-Auto-Akku bei hohen Ladeleistungen zu groß ist und oft unnötige Kosten verursacht, sind geringere Ladeleistungen bei Ladestationen zu Hause zu empfehlen. Im Gegensatz zu Schnellladestationen an Autobahnen sollten im Wohnbereich deshalb maximal 11 kW (in den meisten Fällen reichen auch bereits 3,7 kW aus) zum Einsatz kommen. So kann das E-Auto über Nacht verlässlich und günstig wieder voll geladen werden.
Zusammenfassend brauchen E-Autos definitiv länger als Verbrenner für das Tanken. Doch dank Ultraschnellladestationen nähert sich diese Zahl allmählich dem fossilen Betanken an. Zudem haben E-Autos den immensen Vorteil, dass sie dank ihrer flexiblen Infrastruktur deutlich einfacher während ihrer Stehzeit geladen werden können - denn sie können das Auto auch über Nacht zuhause, im Hotel oder auf der Arbeit aufladen.
In Zeiten vor dem BEÖ (Bundesverband Elektromobilität Österreich) war es in Österreich so, dass jeder Landesenergieversorger sein eigenes Ladenetz und auch seine eigenen Ladekarten bzw. Lade-Apps hatte. So musste man als E-Autofahrer:in mehrere Ladekarten mit sich führen, um quer durch Österreich zu kommen.
Der Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) vertritt die Interessen von elf Energieunternehmen in Österreich und setzt sich für den flächendeckenden Ausbau von Elektromobilität unter Verwendung von erneuerbarer Energie ein. So konnte auch ein flächendeckendes österreichweites Ladenetz geschaffen werden. Als E-Auto-Nutzer:in kann man sich eine Ladekarte oder eine Lade-App eines Energieunternehmens ordern. Mit dieser Ladekarte bzw. -App erhält man Zugang zum Ladenetz der elf Anbieter. Aus kartellrechtlichen Gründen darf es aber keinen einheitlichen Ladetarif geben - daher haben alle elf Anbieter unterschiedliche Ladetarife ( BEÖ, 2022).
BEÖ, 2022).
Möchte man mit dem E-Auto europaweit unterwegs sein, bieten einige BEÖ-Mitglieder mit ihren Ladekarten bzw. -Apps auch die Möglichkeit an, im Ausland zu laden. Es gibt aber bereits einige Unternehmen, die europaweites Aufladen ermöglichen.
Zu wenig Modelle, keine Gebrauchtwagen, ineffizient und sogar gefährlich - bei all diesen Kritikpunkten erscheint es unmöglich, dass E-Autos wirklich jemals Fuß fassen können und dass wir uns am besten wieder auf den Verbrenner rückbesinnen sollten. Hier werden diese Kritikpunkte näher unter die Lupe genommen:
 Video: Mythos 4: Es gibt zu wenige E-Autos und sie sind keine echte Alternative zu fossilen PKWs.
Video: Mythos 4: Es gibt zu wenige E-Autos und sie sind keine echte Alternative zu fossilen PKWs.
Viele denken, dass man bei E-Autos keine große Auswahl an Marken und Modellen hat. Aber: Das Repertoire nimmt stetig zu. Der Markt wächst und so gibt es auch vermehrt Angebote, vom Klein- bis hin zum Lieferwagen. Informationen zu aktuellen E-Autos findet man unter anderem in facheinschlägigen Zeitschriften bzw. auch online auf  topprodukte.at von klimaaktiv oder beim Autohandel in Ihrer Nähe.
topprodukte.at von klimaaktiv oder beim Autohandel in Ihrer Nähe.
Es sind zwar erst wenige zehntausend E-Autos auf Österreichs Straßen unterwegs, aber es gibt bereits einen Gebrauchtwagenbestand von etwa 177.000 E-Autos ( austriatech, 2024). Händler:innen bieten unter Umständen attraktive Preise an, wenn Modelle technisch oder optisch überarbeitet werden, um den „Altbestand" verkaufen zu können.
austriatech, 2024). Händler:innen bieten unter Umständen attraktive Preise an, wenn Modelle technisch oder optisch überarbeitet werden, um den „Altbestand" verkaufen zu können.
Reichweite ist oft ein zentrales Kaufkriterium bei E-Autos, da viele Menschen Angst haben, am Weg liegen zu bleiben. Aber: Im Durchschnitt fährt jede:r Österreicher:in jährlich 6.530 km - weniger als 34 km täglich. Selbst weniger reichweitenstarke E-Autos mit 300 bis 400 km sind für den Großteil unserer Fahrten mehr als ausreichend.
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kosten eines E-Autos: In der Anschaffung sind diese teurer als fossile PKWs. Allerdings gleichen sich die Preismargen mit jedem Jahr weiter an, sodass neuwertige E-Autos heute bereits preislich mit neuwertigen Verbrennern vergleichbar sind. Speziell Lithium-Ionen-Akkus (Li-ion-Akkus) haben in den vergangenen zehn Jahren einen signifikanten Preissturz erlebt - von fast 750 Dollar/kWh in 2013 auf etwa 150 Dollar/kWh in 2023 (Statista, 2024).
Dank geringerer Betriebskosten amortisiert sich der Kauf eines E-Autos innerhalb von etwa 2,5 Jahren. Laufende Kosten wie Versicherungssteuer und Servicekosten sind bei E-Autos deutlich geringer. Tank- bzw. Ladekosten sind ebenfalls ein Thema: Ein durchschnittlicher Mittelklasse-PKW benötigt für 100 km rund 5 l Diesel, ein E-PKW etwa 15 kWh. Bei einem Dieselpreis von € 1,10/l und einem Strompreis von € 0,19/kWh kosten 100 Kilometer mit Diesel € 5,50 und mit Strom € 2,85. Und auch finanzielle Anreize wie Förderungen und der Entfall der NoVA reduzieren die Investitionskosten ( Klima- und Energiefonds & VCÖ, 2018). Praktische TCO-Rechner im Internet helfen Ihnen beim Vergleich der Gesamtkosten eines Fahrzeugs.
Klima- und Energiefonds & VCÖ, 2018). Praktische TCO-Rechner im Internet helfen Ihnen beim Vergleich der Gesamtkosten eines Fahrzeugs.
Schlussendlich ist die Effizienz von E-Motoren höher als die von fossilen Motoren. Fossile Fahrzeuge haben einen Wirkungsgrad von 18 Prozent bis 25 Prozent, während E-Motoren zwischen 85 Prozent und 90 Prozent liegen. Wasserstofffahrzeuge erreichen etwa 22 Prozent, E-PKWs rund 50 Prozent ( FIS, 2023).
FIS, 2023).
Der Akku ist eines der wichtigsten Elemente in einem E-Auto. In ihm wird die Energie gespeichert, die zur Fortbewegung benötigt wird - wie der Tank bei einem fossilen PKW. Daher muss sichergestellt werden, dass der Akku bei Einwirkungen von außen und innen stets sicher ist und auch bleibt.
Für die Markteinführung von Traktionsbatterien bzw. Hochvoltspeichern für Fahrzeuge ist die Prüfung nach ECE-R100.02 sowie eine Typzulassung (Homologation) der Traktionsbatterien bei einer nationalen Kraftfahrzeugbehörde erforderlich. Ohne eine Typgenehmigung kann keine Traktionsbatterie in Europa und in außereuropäischen Ländern, die die ECE-Regelungen anerkennen, auf den Markt gebracht werden. Somit ist die Prüfung nach ECE-R100.02 für Traktionsbatterien in Elektro- und Hybridfahrzeugen zwingend erforderlich.
Des Weiteren werden Crashtests an Fahrzeugbatterien durchgeführt. Bei einem Crashtest werden wirklichkeitsgetreue Unfallszenarien simuliert. So können fundierte Informationen über die Sicherheit der Batterie bei einer Verformung der Fahrzeugkarosserie gewonnen werden. Auch für Crashtests gibt es ein eigenes Regelwerk, wie diese ablaufen müssen.
Somit kann sichergestellt werden, dass die Akkus von E-Autos allen technischen Anforderungen entsprechen und gegen Einflüsse von außen und innen bestehen können.
Im Vergleich zu fossilen Fahrzeugen weisen E-Autos keine höheren Sicherheitsrisiken auf. Das Hauptrisiko liegt aber beim Akku, jedoch ist dieser durch Stahlplatten sehr gut gesichert bzw. hat jeder Akku ein sogenanntes Batteriemanagement, welches das Fahrzeug im Falle eines Unfalles stromlos/spannungsfrei schaltet. Das bedeutet, dass in den Leitungen kein Strom mehr fließt, alle Stromverbraucher ausgeschaltet sind und die Rettungskräfte bzw. Ersthelfer keinen Stromschlag fürchten müssen.
Die Brandgefahr ist bei einem fossilen Fahrzeug gleich hoch wie bei einem E-PKW. Die Akkus sind jedoch so konzipiert, dass sie Selbstentzündungen vermeiden und ggf. den Akku stromlos schalten können. Sollte ein E-Auto (oder auch Plug-in-Hybrid) zu brennen beginnen, kann die Feuerwehr den Brand mit Wasser löschen. Ob bei einem E-Auto-Brand auch der Akku in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist nicht immer leicht erkennbar, daher verwenden die Feuerwehren zumeist mehr Wasser, um den Akku ggf. kühlen zu können. Des Weiteren werden Thermografie-Kameras eingesetzt, um eine mögliche Wärmeentwicklung im Akku rechtzeitig feststellen zu können. Für das Löschen eines E-Autos gelten dieselben Anforderungen wie für das Löschen eines fossilen Fahrzeuges ( OÖ Energiesparverband, 2020).
OÖ Energiesparverband, 2020).